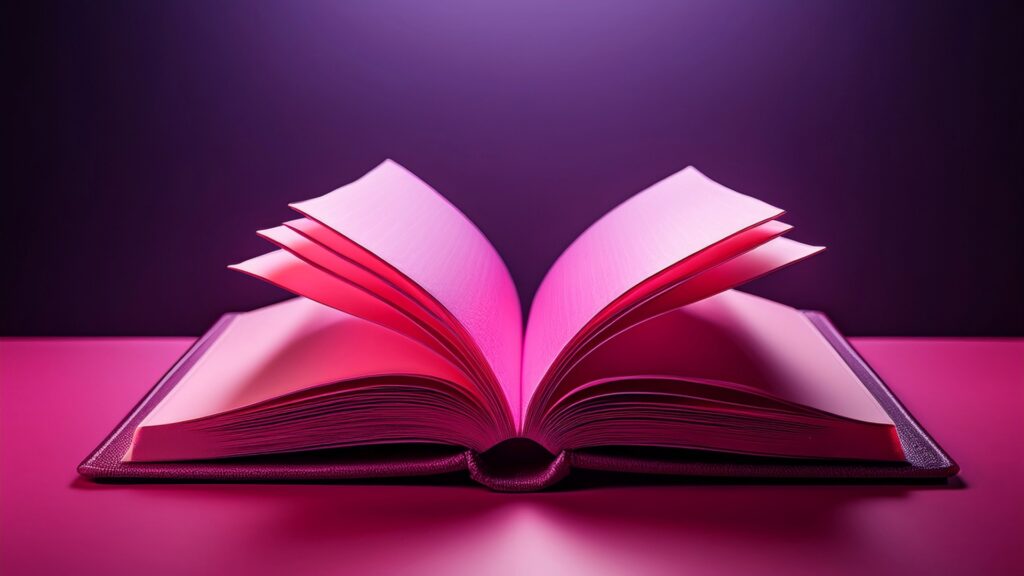
Swantjes Sexismus-Tagebuch — Eintrag 0
Ich arbeite in einem kleinen, liebevoll geführten Brettspielverlag. Als einzige Frau. Lange Zeit habe ich gedacht wie meine Kollegen: „Das Geschlecht ist doch egal. Wir sind alle ein Team.“ Das stimmt — aber eben nicht ganz.
Worin der Unterschied liegt
Ich liebe meine Kollegen — ABER
Meine Kollegen kennen nicht die Angst, abends allein im Dunkeln nach Hause gehen zu müssen. Sie werden nicht beim Joggen angehupt, niemand kommentiert ihren Körper auf offener Straße, und ihre Aussagen werden oft ernster genommen.
Ich erlebe das anders. Einmal hat ein fremder Mann im Bus neben mir angefangen, seinen Penis zu reiben. Ja, ernsthaft! Dazu hat niemand etwas gesagt — aber das Thema behalte ich für ein anderes Mal.
In diesem Tagebuch will ich erklären, warum ich mich als Frau in überwiegend männlichen Umfeldern oft unsicher und unwohl fühle. Ich schreibe aus meiner Perspektive: subjektiv, als Swantje. Ich kann nicht für alle FLINTA*s sprechen – nur aus meiner Perspektive als weiße cis-Frau. Vielleicht hast du selbst ein Tagebuch? Oder fängst jetzt eines an? Ich würde mich freuen, davon zu lesen.
Ehrlich: Ich mag meine Kollegen. Manche mehr als andere, aber im Großen und Ganzen sind sie großartig. Trotzdem fühle ich mich nicht immer komplett dazugehörig. Es gibt Situationen bei der Arbeit und auf Messen, in denen deutlich wird, dass die Erfahrungswelt einer Frau anders ist als die eines Mannes. Und das macht einen Unterschied.
Ich möchte erzählen: davon, wie es ist, wenn mein Hintern wichtiger scheint als meine Worte. Wie es ist, wenn mein Körper öffentlich kommentiert wird. Wie es ist, abends im Park vor jedem Mann auf der Hut zu sein. Vielleicht wird so klarer, warum Dinge, die für meine Kollegen kaum merkbar sind, für mich einen großen Einfluss haben.
Berlin Brettspiel Con —
und das Kompliment, das keins war
Bei der Berlin Brettspiel Con haben wir als Verlag Spielrunden von Blood on the Clocktower betreut — organisatorisch, damit die Runden nicht überlaufen. Ich habe regelmäßig neue Gruppen hereingelassen. Irgendwann kommt ein Mann auf mich zu — schwarzes T-Shirt, kurze Haare, etwas älter als ich — und sagt: „Na, bist du nicht viel zu hübsch für Blood on the Clocktower?“
Vielleicht hat er sich charmant gefühlt? Man weiß es nicht. Ich fand es nicht charmant und habe ihn gebeten, zu gehen und nie wieder zu kommen. Er fand das übertrieben. „Ich habe dir doch nur ein Kompliment gemacht.“ Standardantwort. Kenne ich.
Mit etwas Abstand bin ich nicht mehr wütend, eher genervt. Perfekt, um zu erklären, warum er mit meiner Reaktion leben muss. Ich bin nicht dafür da, dass er sich gut fühlt.
Warum das kein harmloses Kompliment war
- Arbeitskontext: Ich bin in meinem beruflichen Umfeld, trage ein Namensschild und arbeite. Wie ich aussehe, ist irrelevant. Mein Aussehen ist nicht dafür da, andere zu erfreuen — schon gar nicht ungefragt kommentiert zu werden. Wenn du wirklich etwas Nettes sagen willst: Frag vorher. Ein einfaches „Ist es okay, wenn ich dir ein Kompliment mache?“ — das tut nicht weh und respektiert Grenzen. Das bedeutet aber auch, dass du mit einem Nein leben können musst.
- Kein Anspruch auf Zustimmung: Es gibt kein Grundrecht auf Komplimente. Du darfst meine Optik bewerten — aber ich bin nicht verpflichtet, das zu akzeptieren oder mich darüber zu freuen. Deine Aufmerksamkeit ist kein Ritterschlag.
- Aussehen vs. Kompetenz: Mein Aussehen hindert mich nicht daran, komplex zu denken oder Spiele zu spielen. Es gibt keine Attraktivitäts-Türsteher*innen, die mich abhalten. Ich erledige meine Arbeit — trotz der Bürde des Aussehens.
- Die eigentliche Kränkung: Viel problematischer ist, dass Menschen offenbar glauben, mein Aussehen mache mich weniger fähig. Das Verhalten hinter dem „Kompliment“ war Ausdruck von Arroganz und fehlender Empathie: Er hat mich nicht als Vertreterin eines Verlags gesehen, sondern als hübsches Ding, das seiner Aufmerksamkeit würdig ist.
Gesellschaftliche Muster: Warum so ein Spruch mehr sagt als er vorgibt
Wenn mir jemand auf einer Con ins Gesicht sagt: „Du bist viel zu hübsch für dieses Spiel“, dann klingt das auf den ersten Blick vielleicht wie ein netter Versuch, ein Gespräch zu beginnen. Ist es aber nicht. Und ich habe dann auch keine Lust auf ein Gespräch. Solche Sätze packen mich in eine Schublade: zuerst Körper, dann Persönlichkeit, Kompetenz und Erfahrung kommen an zweiter Stelle — wenn überhaupt. Dieser Satz ist nicht in seinem singulären Auftreten verletzend. Das Problem ist, dass das kein Einzelfall ist: Das ist Alltag. Unsere Gesellschaft misst Frauen häufig mehr am Aussehen als an dem, was sie tun oder können. Unter dem Deckmantel von Höflichkeit wird so beiläufig abgesprochen, dass Frauen in Bereichen wie Beruf, Hobby oder Öffentlichkeit gleichwertig mit Männern agieren können.
Kurz: Das „Kompliment“ reduziert. Es entzieht mir die berufliche Identität im Moment, in dem es fällt — und das ist verletzend, weil es nicht meine Realität trifft. (Diese Muster sind nicht neu in der Forschung: Alltagssexismus, Objektifizierung und die Reduktion von Frauen auf Erscheinung werden vielfach dokumentiert.)
In der Brettspielszene: Wie sich die Muster konkret zeigen
Und ja — diese gesellschaftlichen Muster finden sich auch in der Brettspielwelt. FLINTA*s sind in Design, Entwicklung und auf den großen Preislisten deutlich unterrepräsentiert; das hat z. B. Elizabeth Hargrave thematisiert und mit Zahlen belegt. Es sind nicht nur Einzelfälle, es ist ein Muster: wenige Autor*innen, wenige Sichtbarkeits- und Förderstrukturen, und dadurch ein Pipeline-Problem, das auf allen Ebenen wirkt.
Gleichzeitig tauchen in Spielen Illustrationen, Klischees und Mechaniken auf, die stereotype Bilder bestärken — das wurde zuletzt bei Veröffentlichungen und Kontroversen deutlich diskutiert. In Community- und Vereinsstrukturen gibt es immer wieder Gatekeeping-Momente: „Das ist eher was für Jungs“ (Kotz!) oder unterschwellige Annahmen, dass FLINTA*s weniger wissen und sich dadurch länger beweisen müssen. All das sorgt dafür, dass FLINTA*s öfter aus gesellschaftlichen Räumen gedrängt oder aufgrund ihres Aussehens kommentiert werden —anstatt als vollwertige Mitspieler*innen und Kolleg*innen wahrgenommen zu werden.
"Das Problem ist, dass das kein Einzelfall ist: Das ist Alltag. "
Wie beide Ebenen zusammenwirken
Gesellschaftliche Rollenbilder und die Strukturen in der Szene befeuern sich gegenseitig. Wenn die allgemeine Erwartung lautet, Frauen seien „zuerst Körper“, dann werden Verlage, Jurys, Communitys und Illustrator*innen unbewusst nach diesen Kategorien handeln — sei es bei der Auswahl von Autor*innen, beim Marketing oder bei gestalterischen Entscheidungen. Umgekehrt verstärken dann problematische Spiele, unreflektierte Community-Statements und fehlende Sichtbarkeit von FLINTA*s genau das gesellschaftliche Narrativ, dass FLINTA*s „nicht richtig“ in Fachrollen sehen will.
Deshalb ist ein einzelner Spruch wie „zu hübsch für…“ nicht harmlos. Auch nicht charmant. Auch nicht nett. Er sitzt an der Nahtstelle zwischen individuellem Verhalten und struktureller Erwartung — und ist deshalb symptomatisch für etwas Größeres: ein System, das FLINTA*s weniger Raum zur Teilhabe und weniger Anerkennung ihrer Kompetenzen zugesteht.
Wo du dich weiter informieren kannst
(Mach das, Wissen ist Macht!)
1. Elizabeth Hargrave – Threads & Interviews
Hargrave hat das Problem der Unterrepräsentanz in sichtbareren Zahlen benannt (z.B. zu Spiel des Jahres-Nominierungen). Gut zum Verstehen, wie ein Branchen-Insider das Pipeline-Problem erklärt.
Mollie Russell: Wingspan creator highlights lack of diversity in board game award.
Elizabeth Hargrave: Women & Nonbinary Board Game Designers.
2. Wissenschaftliche Artikel/Studien zu Sexismus in Tabletop-Kulturen
Forschung wie „Sexism, Stereotypes and Subcultural Capital in Board Gaming“ erklärt das Phänomen systematisch — also nicht nur Einzelfälle, sondern Mechanismen. Hervorragend, wenn du tiefer in Theorien und Studienergebnisse einsteigen willst.
PDF-Version: Ryan Scoats & Marcus Maloney: ’Oh you’re really good for a girl’: Sexism, Stereotypes and Subcultural Capital in Board Gaming.
3. Spielpunkt.net – Debatten & Beispiele aus der Szene (DE)
Für deutschsprachige Fälle und Diskussionen ist Spielpunkt eine gute Quelle, weil sie Kontroversen dokumentiert und Verlagssicht sowie Community-Reaktionen zusammenbringt.
André Volkmann: Stereotype Brettspiele? Tukdatu löst Rassismus-Diskussion aus. (Spielpunkt.net)
4. Community-Plattformen & Diskussionsforen (BoardGameGeek, FLINTA*stisch, wo auch immer du dich rumtreibst!)
Für Stimmen aus der Szene selbst (Erfahrungsberichte, Beispiele, Debattenverlauf) sind BGG-Threads und spezialisierte Foren unschlagbar. Dort siehst du, wie Diskussionen wirklich laufen — und kannst auch aktiv teilnehmen.
BoardGameGeek Community: Women and Gaming – Active | Forums (BoardGameGeek).

Als Marketing-Managerin bei Funtails macht sie aus guten Spielen echte Geschichten: Strategie trifft Design, Zielgruppe trifft Herz. Wenn sie nicht gerade Produkttexte verfeinert oder Messeauftritte plant, isst sie am liebsten Rosenkohl.
Ich bin sehr dankbar für diesen Text und für die mutige Haltung, solche Probleme deutlich anzusprechen. Mir als Mann geht es manchmal so, dass ich mich regelrecht schäme, wenn andere Männer sich derart überheblich, unsensibel und unreflektiert verhalten. Es ist ein grundlegend strukturelles, gesellschaftliches Problem, und deshalb macht Sexismus auch nicht vor der vermeintlich harmonischen, ach so harmlosen Brettspiel-Welt halt. Das fängt schon bei der Gestaltung an – Allein im Genre Fantasy gibt es so wenige stilvolle Illustrationen, dafür aber so viel Müll, wo Frauen-Figuren standardmäßig mit Röckchen und tiefem Ausschnitt gezeigt werden, dass mir der Spaß an entsprechenden Spielen direkt vergeht. Und dann diese dämlichen Kommentare wie von Dir geschildert – derartige Hirnlosigkeiten sind in Spielerunden auch immer wieder zu hören, und es muss für Frauen echt unerträglich sein. Was ist los mit diesen Typen? Wie niveaulos kann man sein, dass man Frauen herabwürdigend behandelt? Dass man Menschen (gewollt oder ungewollt) ausgrenzt? Wie paradox, wo es doch gerade beim Spielen darum geht, sich zu begegnen und gemeinsam Spaß zu haben. Was kann ich tun? Ich kann unseren Sohn dafür sensibilisieren, dass er diskriminierende Haltungen sich nicht zu eigen macht, sondern ablehnt – das ist schon mal ein Schritt. Aber da hört es nicht auf. Wir müssen uns ebenso in Freundeskreisen etc. immer wieder einmischen. Ich möchte insbesondere alle Männer ermutigen, etwas zu sagen, wenn so ein Kommentar, ein übergriffiges ‚Kompliment‘ oder gar Schlimmeres passiert. Es ist leider notwendig und wichtig, dass Frauen gegen Sexismus kämpfen, und es ist ebenso wichtig, dass wir Männer solidarisch mit ihnen sind und entsprechend bei jeder Entgleisung zeigen, dass wir überhaupt nicht damit einverstanden sind. Diejenigen, die andere Menschen respektlos behandeln, sind schlimm, aber kein bisschen besser sind diejenigen, die daneben stehen und schweigen.
Hallo Marcel, es ist sehr schön, das von dir zu lesen! Danke für die Bestärkung. Das macht viel aus, auch wenn es sich für dich vielleicht nicht immer so anfühlt.
[…] FLINTA*stisch (📝): Nur nicht in der August-Ausgabe erwähnt, weil ich ihn am 31.08. übersehen habe. In ihrem Sexismustagebuch beschreibt SWANTJE (Marketing Managerin bei FUNTAILS), warum sie sich manchmal in der Brettspielszene unwohl fühlt, und reichert das Ganze über viele weiterführende Links an. […]
Ui, das sind viele interessante Beiträge, die du gesammelt hast! Da lohnt sich das Weiterlesen auch. 🙂
„Deshalb ist ein einzelner Spruch wie „zu hübsch für…“ nicht harmlos. Auch nicht charmant. Auch nicht nett.“
Ich finde ihn auch nicht nett, weil er auch bedeuten könnte, dass da normalerweise ein bestimmter Typus Frau erwartet werden könnte, der nicht als hübsch angesehen werden könnte. Wer definiert allerdings hübsch?
Interessanter Gedanke, Martina – der in diesem Text kaum Raum bekommen hat. Ich habe schon auf meiner Liste, dass ich vielleicht in Zukunft ausführlicher von dieser Seite auf das Thema schaue. Also teile gern weitere Gedanken dazu!
Der Begriff definiert sich nach dem Duden wie folgt: „ein angenehmes, gefälliges Äußeres aufweisend; von einer Erscheinung, Gestalt, mit Gesichtszügen, die Wohlgefallen erregen“; „jemandes Gefallen, Zustimmung findend, jemandes Geschmack treffend“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/huebsch)
Der Begriff beschreibt also eine subjektive Bewertung einer (visuellen) Erscheinung. Oft wird der Begriff für Gegenstände oder Frauen/Mädchen verwendet – was man schon beim Dudeneintrag einfach erkennen kann.
Ohne also zu weit ausholen zu wollen: Es geht dabei oft um die Bewertung einer meist weiblichen Erscheinung nach subjektivem Wohlgefallen. Die Zuschreibung ist also eng mit demjenigen verknüpft, der sie vornimmt.
Die Zuschreibung „hübsch oder nicht“ ist sehr komplex und kann Ausdruck eines Machtgefälles sein. Wie bei GNTM. 😉
Warum ist es überhaupt wichtig, dass dieser jemand die anderen Frauen nicht hübsch findet? Das ist keine rhetorische Frage – und es gibt viele interessante Antworten von unterschiedlichsten Denker*innen dazu. Was denkst du dazu?